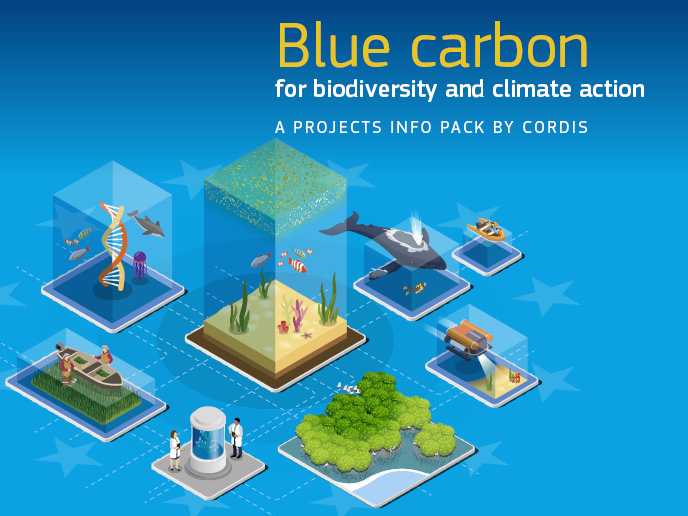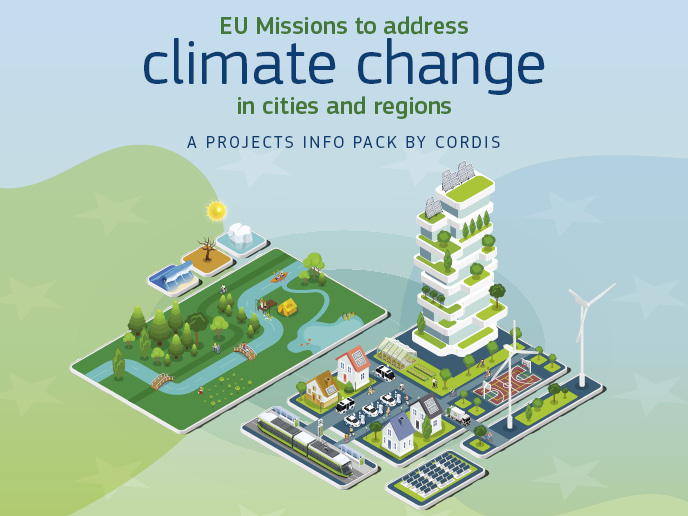Bekämpfung der Ausbreitung invasiver Arten
Der Marderhund ist nicht mit den Waschbären verwandt – er ist eine Hundeart von der Größe eines Fuchses, aber mit kürzeren Beinen und einem kürzeren Schwanz. Sein natürliches Verbreitungsgebiet ist Ostasien, er wurde jedoch in die europäischen Teile der ehemaligen Sowjetunion eingeführt, wo er für sein Fell gezüchtet wurde. Von dort hat er sich auf Teile Nord- und Osteuropas verbreitet. Frühere Forschungsarbeiten haben einige Erkenntnisse über die Umweltbedingungen ergeben, an die sich N. procyonoides angepasst hat. Allerdings fehlte den Wissenschaftlern bislang das grundlegende Verständnis über die genetischen Mechanismen, die diese drastische Ausbreitung ermöglichen konnten. Das EU-finanzierte Projekt EUROINVADERS (Understanding the evolutionary mechanisms of invasion success: Selective footprints in the genome of an Euro-invader – the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides)) nahm sich dieses Problems an und führte mithilfe von Next-Generation Sequenziertechnologien eine genetische Studie durch. In der ersten Phase des Projekts wurde eine "Bibliothek" aus sämtlichen Genen angelegt, die sich jeweils in den drei asiatischen und den drei europäischen Marderhundarten exprimierten. Somit konnte man populationsspezifische Muster untersuchen, um den Genen auf den Grund zu kommen, die sich in den unterschiedlichen Umgebungen, an die sich die Marderhunde angepasst haben, auf unterschiedliche Weise ausprägen. In der zweiten Phase möchte man ein besseres Verständnis für den Diversifizierungsprozess erzielen, der über einen kurzen Zeitraum bei verschiedenen Populationen auftrat. Durch eine Untersuchung unterschiedlicher Chromosomenanordnungen auf Nukleotidebene konnte man die genomischen Regionen identifizieren, die an der Artbildung und den Diversifizierungsprozessen beteiligt sind. Marderhunde zählen zur Familie der Canidae, zu der auch der Hund gehört. Die im Projekt EUROINVADERS gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um den Ursprung und den Zeitpunkt der Domestikation des Hundes besser verstehen zu können. Somit konnte man den Hund als Referenz verwenden, um nachzuvollziehen, wie eine genetische Variation bei Arten auftreten kann. Aufgrund seiner raschen Verbreitung in Europa und weil er als Problemart identifiziert wurde, diente der Marderhund als Modellorganismus, um die evolutionären Mechanismen zu untersuchen, die hinter dem Invasionserfolg stecken. Die Ergebnisse aus dem Projekt EUROINVADERS werden die Entwicklung wirksamer Bewirtschaftungspläne zur Eindämmung von N. procyonoides und anderer invasiver Arten erleichtern. Die Projektergebnisse sollten daher zum Schutz der einheimischen Flora und Fauna beitragen.