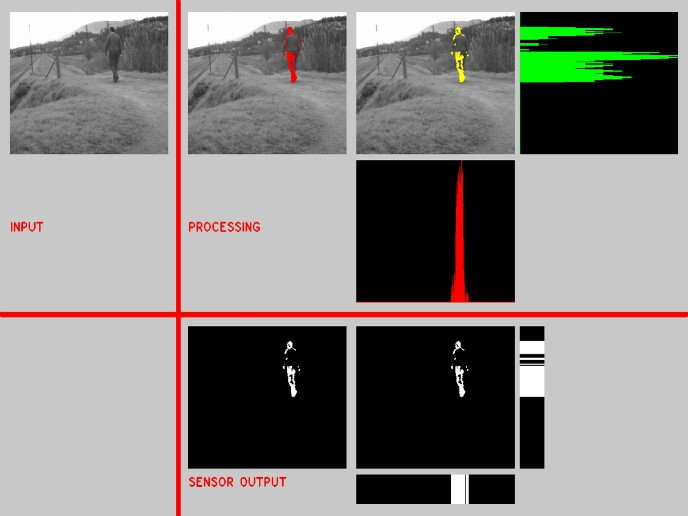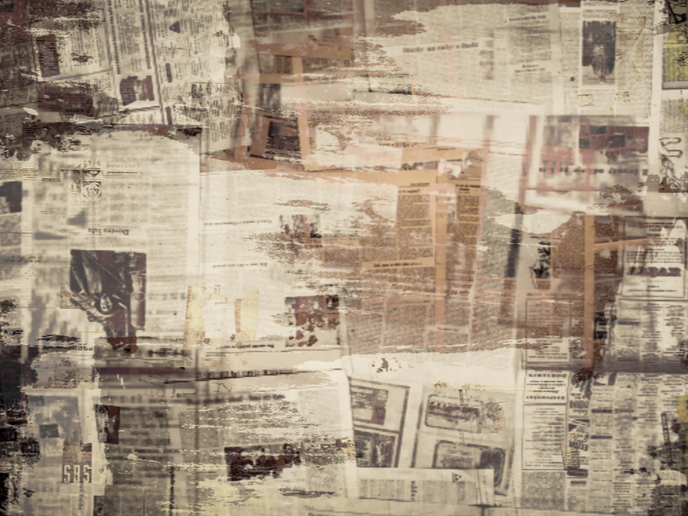Entschlüsselung der Geheimnisse hinter der Mumifizierung
Trotz der zentralen Rolle von Mumien in der Archäologie ist über die Mumifizierung vor der Bestattung erst überraschend wenig bekannt. „Auf welche Weise menschliche Überreste vor ihrer endgültigen Deponierung behandelt werden, lässt sich nur schwer ausmachen“, sagt Eline Schotsmans(öffnet in neuem Fenster), Marie-Skłodowska-Curie-Stipendiatin(öffnet in neuem Fenster) an der Universität Bordeaux(öffnet in neuem Fenster) in Frankreich. Dies liege daran, dass das noch erhaltene Weichgewebe nach mehreren Tausend Jahren zum größten Teil abgebaut ist. „Da die archäologischen Aufzeichnungen lediglich die endgültige Deponierung von menschlichen Überresten dokumentieren, werden die Bestattungspraktiken oft nicht als dynamischer Prozess betrachtet, der sich aus mehreren Phasen über einen längeren Zeitraum hinweg zusammensetzt“, ergänzt sie. Es gibt zwar verschiedene Methoden, die zur Erkennung einer Mumifizierung vor der Bestattung eingesetzt werden, doch bisher wurde keine davon formell validiert. Mit Unterstützung des EU-finanzierten Projektes ArchFarm machte sich Schotsmans daran, dies zu ändern. Zu diesem Zweck besuchte sie eine Body Farm in Australien.
Botschaften aus dem Grab
Als eine der wenigen archäologischen Fachpersonen, die an einer Einrichtung für taphonomische Forschung (allgemeinsprachlich auch als „Body Farm“ bezeichnet) arbeitete und sich die Grundlagen der Forensik zunutze machte, stellte Schotsmans mit ihrer Feldstudie in der archäologischen Welt eine Art Novum dar. „Die Bestattungsbehandlung der Toten gewährt Einblicke in das menschliche Verhalten, die soziale Organisation und die Ideologie früherer Gesellschaften, deshalb ist eine sorgfältige Analyse der Bestattungsbehandlung wichtig, um ein wirkliches Verständnis von einer bestimmten Gesellschaft zu erhalten“, merkt Schotsmans an. Ihre Experimente konzentrierten sich auf Begräbnisse und die Bestattungsabfolgen im Vorderen Orient der Jungsteinzeit und wurden an der Australian Facility for Taphonomic Experimental Research(öffnet in neuem Fenster) (AFTER) durchgeführt. Laut Schotsmans lieferte diese Arbeit nähere Einblicke in die Prozesse der natürlichen Mumifizierung. So konnten die Forschenden beispielsweise zeigen, dass Mumien, wie alle Toten, die üblichen Phasen der Verwesung durchmachen – von Blähung bis zu starker Fäulnis und dem Austritt von Verwesungsflüssigkeiten. „Ein Mensch kann nicht von einer Form aus Fleisch und Blut zur Mumie werden, ohne zuerst Feuchtigkeit und Flüssigkeiten zu verlieren“, erläutert Schotsmans. „Dass die Fäulnis in Mumien gestoppt wird oder gar nicht stattfindet, ist also eine Fehlauffassung.“ Die Forschenden stellten außerdem fest, dass die Luftströmung und die Verdunstung Schlüsselfaktoren im Mumifizierungsprozess sind. „Viele glauben, dass trockene Bedingungen eine Grundvoraussetzung sind, doch Mumien können auch bei täglichem Niederschlag mit viel Wind entstehen“, so Schotsmans. „Wir erhielten die beste Mumie während der australischen Regenzeit mit täglichem Regen bei hohen Temperaturen und günstiger Luftströmung.“
Tod und Zersetzung
Die Forschung von Schotsmans zeigte eindeutig, dass ohne die Untersuchung der Deponierungsumgebung und ein genaues Verständnis des Verwesungsprozesses keine gründliche archäoanthropologische Analyse möglich ist. „Viele Fachleute aus der Archäoanthropologie hatten noch nie mit Toten oder verwesenden Leichen zu tun“, sagt sie. „Doch ohne das Wissen über die Verwesung und die Einflussfaktoren der Zersetzung ist es extrem schwer, Skelettüberreste zu analysieren und Bestattungspraktiken richtig zu interpretieren.“ Das mag zunächst einfach klingen. Doch die wichtigste Erkenntnis aus diesem Projekt sei es, bei der Anwendung der Methoden mit kritischem Auge und nicht zu starr vorzugehen. „Hypothesen und Interpretationen sollten immer mit Vorsicht behandelt und validiert werden“, merkt sie abschließend an. „Experimentelle Ansätze stellen eine wertvolle Ergänzung zur archäologischen und anthropologischen Forschung dar.“ Die Forschungsarbeit von Schotsmans wird in einem Buch über Archäothanatologie vorgestellt, das sie zusammen mit dem Forscher Christopher Knüsel(öffnet in neuem Fenster) herausgab. Dank eines Zuschusses vom Australian Research Council(öffnet in neuem Fenster) wird sie ihre Experimente in Australien zudem fortführen.