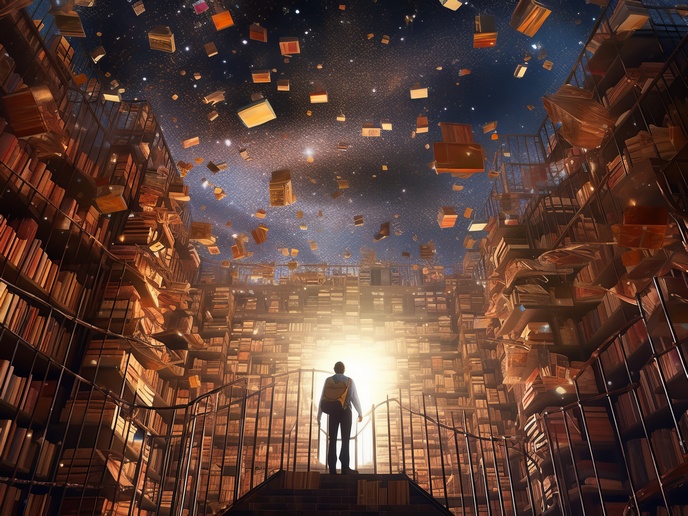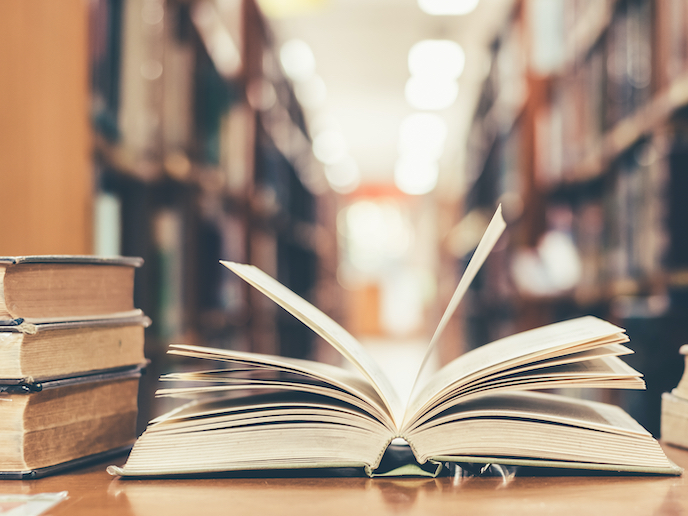Das Bild Japans in der Vorstellung der extremen Rechten
Wie genau wurden Darstellungen Japans zu einem integralen Bestandteil der extremen rechten Ideologien? Das EU-finanzierte YTOPIA(öffnet in neuem Fenster) –Projekt versuchte, diese Frage zu beantworten, indem es untersuchte, wie Japan in Nazi-Deutschland und im faschistischen Italien in der Mitte des 20. Jahrhunderts dargestellt wurde. Insbesondere befasste sich das Projekt mit der utopischen Dimension bestimmter Darstellungen Japans, die zur Projektionsfläche für die Werte und politischen Bestrebungen der extremen Rechten in Europa wurden.
Fragen im Zusammenhang mit der kollektiven Identifikation
Das im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) finanzierte Projekt YTOPIA brachte den Betreuer Toshio Miyake von der Universität Venedig(öffnet in neuem Fenster) in Italien und dem Marie-Curie-Stipendiaten Nicola Bassoni zusammen. „Ich bin auf Orientalismus und Okzidentalismus spezialisiert, insbesondere auf Darstellungen des sogenannten Westens in Asien und Darstellungen des sogenannten Ostens in Europa, vor allem in Italien“, erklärt Miyake. „Ich interessiere mich für Themen im Zusammenhang mit kollektiven Identifikationen.“ Miyake erhielt 2011 ein Marie-Curie-Stipendium für ein Projekt namens BETWATE. Dieses konkrete Projekt konzentrierte sich auf gegenseitige Diskurse und Praktiken in Bezug auf „Japan“ und „den Osten“ in Italien sowie in Bezug auf „Italien“ und „den Westen“ in Japan. Im Jahr 2022 wurde Miyake von Bassoni kontaktiert, einem Historiker, der sich auf Nazideutschland und geopolitische Fragen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spezialisiert hat. „Nicola erkannte ebenfalls Verbindungen zwischen Italien und Japan und wollte diese Faszination verstehen“, erklärt Miyake.
Rechtsextreme Ideologie und „Utopie“
Das Projekt brachte Bassoni nach Venedig, wo Miyake zum Thema Orientalismus tätig war. Das Projekt verknüpfte verschiedene Perspektiven auf Geschichte, Kultur und Postkolonialismus. Bassoni interessierte sich insbesondere für den inhärenten Widerspruch in rechtsextremen Ideologien, die eine „Utopie“ idealisieren. Diese Ideen priorisieren zwar Nationalismus und Selbstidentität, wenden sich jedoch auch anderen Bereichen zu, die sie inspirieren und die ihrer Meinung nach bestehende Defizite in ihren eigenen Zivilisationen beheben könnten. In diesem Sinne wurde Japan häufig als „authentisches“, „traditionelles“ und „homogenes“ Land idealisiert. Das Projekt ermöglichte Bassoni einen Aufenthalt an der Universität Konstanz in Deutschland sowie an der Universität Kyoto Sangyo in Japan. Dadurch konnte er die Sprache erlernen, auf Primärquellen zugreifen und mit lokalen Forschenden zusammenarbeiten. Bassoni untersuchte die Entwicklung der Japanbilder in Deutschland und Italien in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und verglich dabei die kulturellen, sozialen und politischen Charakterisierungen Japans, die sie vermittelten.
Herausforderungen und Widersprüche der Moderne
Ein wesentlicher Vorteil des Marie-Curie-Projekts bestand darin, dass es Bassoni ermöglichte, ein internationales Netzwerk von Akademikern und Forschenden aufzubauen. Das Projekt vereinte erfolgreich Personen, die zuvor keinen Kontakt miteinander hatten. Das Projekt besitzt auch in der heutigen Zeit Relevanz. „Die Gegenwart ist nicht dasselbe wie die Vergangenheit“, merkt Miyake an. „Allerdings können wir beobachten, dass viele Ereignisse, die bereits stattgefunden haben, sich wiederholen.“ Miyake ist der Ansicht, dass das anhaltende Wiederauftreten von Utopien in verschiedenen Formen des Postfaschismus Aufschluss über die Herausforderungen und Widersprüche von Gesellschaften geben könnte, die sich an die Moderne anpassen. Er weist auf die inhärente Spannung zwischen der Internationalisierung in der modernen Welt und dem Bedürfnis nach nationaler Identität und Mythen hin. „Wir sollten möglicherweise genauer darüber nachdenken, wie Identitätsbildung entsteht.”