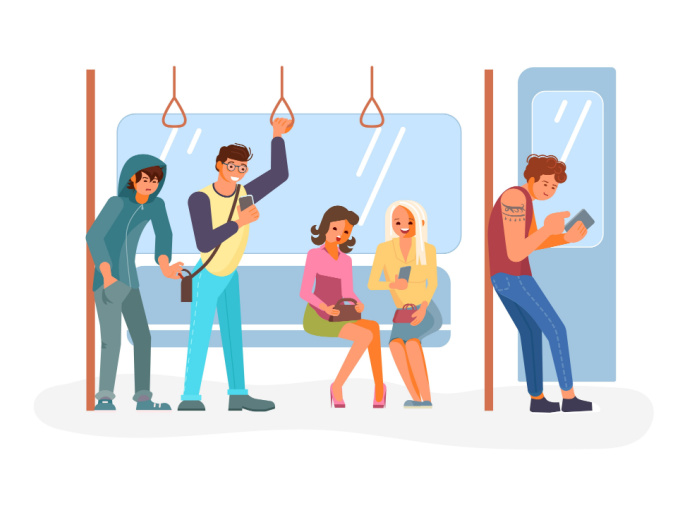Geschlechterungleichheit und Wirtschaft in Afrika südlich der Sahara
In Afrika südlich der Sahara sind die Raten häuslicher Gewalt oder das relative Risiko eines vorzeitigen Todes für Frauen höher als in jeder anderen Region. Die wirtschaftlichen Kräfte, die der Diskriminierung in dieser Region zugrunde liegen, sind jedoch nicht sehr gut erforscht. „Den Ausgangspunkt des Projekts AfricanWomen bildete der Versuch, die Stellung der Frauen in den Privathaushalten und in der Gesellschaft in Afrika südlich der Sahara nicht nur in der Gegenwart, sondern auch aus einer historischen Perspektive besser zu verstehen“, erklärt Projektkoordinatorin Catherine Guirkinger(öffnet in neuem Fenster) von der Universität Namur(öffnet in neuem Fenster) in Belgien. „Es gibt nur wenige quantitative Analysen über die Auswirkungen der Kolonialpolitik, zum Beispiel auf das relative Wohlergehen der Frauen.“
Bildung, Fruchtbarkeit und familienrechtliche Streitigkeiten
Die Arbeit des vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) unterstützten Projekts konzentrierte sich auf zwei Forschungslinien. Zunächst untersuchten Guirkinger und ihr Team die Entwicklung des Wohlergehens der Frauen in der Demokratischen Republik Kongo während und nach der Kolonialzeit, wobei sie aus einer Vielzahl von Archiven Originaldatenbanken aufbauten. Guirkinger betrachtete Themen wie Bildung und Fruchtbarkeit sowie den Ausgang von familienrechtlichen Streitfällen. Das Ziel lautete, die wichtigsten Trends, die das Wohlergehen von Frauen beeinflussten, besser zu verstehen. „Unsere Arbeit deutet darauf hin, dass bestimmte koloniale Politiken, etwa eine geburtenfördernde Politik, die bisher wenig Berücksichtigung fanden, tiefgreifende Konsequenzen für das Leben von Frauen hatten“, sagt sie. „Dies wird sicherlich zu weiteren Forschungen in der Zukunft führen.“
Verstehen, wie in Familien Entscheidungen getroffen werden
Guirkinger erkundete gleichermaßen die Verteilung von Ressourcen innerhalb von Familien und wie neue wirtschaftliche Möglichkeiten oder politische Maßnahmen diese Verteilung verändern können. Beispielsweise erforschte sie in Zusammenarbeit mit der belgischen Entwicklungsagentur(öffnet in neuem Fenster) die Auswirkungen einer Maßnahme, die dazu vorgesehen war, Frauen den Zugang zu wirtschaftlichen Chancen zu erleichtern. „Aus dieser Arbeit sind einige faszinierende Ergebnisse hervorgegangen, insbesondere im Hinblick auf die unsichtbaren Kosten, die von Frauen getragen werden, und darauf, dass bei der Ausrichtung von Interventionen die Polygamie berücksichtigt werden muss“, fügt Guirkinger hinzu. Guirkinger stellt fest, dass in der Literatur polygame Haushalte in der Regel als ineffizient beschrieben werden, weil die Ehefrauen in Konkurrenz zueinander stehen. Guirkingers Forschung fällt jedoch etwas nuancierter aus. Sie stellte fest, dass Ineffizienzen in polygamen Haushalten nicht so sehr auf Wettbewerb zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf die Tatsache, dass es den Frauen an Handlungsmacht fehlt. „Zusammenarbeit ist die wirtschaftlich effizienteste Lösung“, erklärt sie. „Aber wenn es wenig Einfluss und kein Mitspracherecht in einem Haushalt gibt, ist kein Anreiz für eine sinnvolle Zusammenarbeit vorhanden.“
Armutsbekämpfungsmaßnahmen und weitere Forschung
Guirkinger geht davon aus, dass diese Arbeit politische Auswirkungen haben könnte. Armutsbekämpfungsmaßnahmen richten sich meist nur an eine Frau innerhalb eines Haushalts, d. h. im Falle der (in Westafrika häufig vorkommenden) Polygamie an eine Ehefrau. „Unsere Forschung legt nahe, dass die Maßnahmen erfolgreicher wären, wenn beide Ehefrauen direkt angesprochen würden“, erklärt sie. „Das bedeutet eine subtile, aber wirkungsvolle Änderung in der Politikgestaltung.“ Das Projektteam befasste sich auch mit der Einbeziehung von Ehemännern in Maßnahmen, die auf verheiratete Frauen abzielen. „Die Ergebnisse sind subtil, deuten aber an, dass mit der frühzeitigen Einbeziehung von Männern einige Rückschläge zu vermeiden wären“, fügt Guirkinger hinzu. Auch die Forschung im Kongo wird fortgesetzt. Guirkinger ist kürzlich eine Partnerschaft mit Demografiefachleuten eingegangen, um die Daten der einzigen Volkszählung des Landes aus den 1980er Jahren wiederherzustellen. „Eine neue Forschungslinie, die durch die Arbeit in Benin inspiriert wurde, befasst sich mit der Rolle der evangelikalen Kirchen in bestimmten Teilen Afrikas, die insbesondere Frauen anziehen“, merkt sie an. „Unsere Daten legen nahe, dass Frauen möglicherweise konvertieren, um sich wirtschaftlich zu emanzipieren und der traditionellen sozialen Ordnung zu entkommen.“